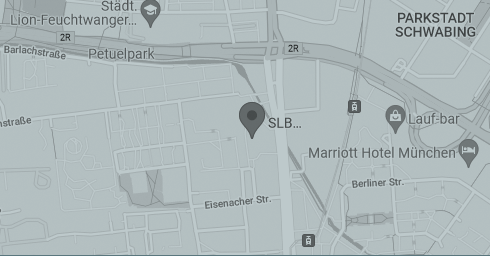Zu hoher Kaufpreis für Kunstwerk oder Antiquität – sittenwidriger Wucher?
Es ist das legitime Ziel eines jeden Galeristen oder Kunsthändlers, im Rahmen von Verkäufen möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Dazu darf er auch überlegenes Wissen zu Marktpreisen nutzen. Problematisch wird das Geschäft allerdings, wenn der Kunsthändler die Unerfahrenheit eines Käufers ausnutzt und das Verhältnis zwischen dem Kaufpreis und dem Marktwert in ein „auffälliges Missverhältnis“ rutscht. Gleiches gilt, wenn sich der Käufer über „wertbildende Faktoren“ des Kaufobjekts irrt. Etwa über den Urheber oder die Provenienz des Kunstwerks. Rechtsanwalt Dr. Louis Rönsberg, der auf Kunstrecht spezialisiert ist, rät daher bei der Preisfindung zur Vorsicht. Denn auch ein Antiquitäten- oder Kunstkaufvertrag kann wegen sittenwidrigem Wucher (§ 138 BGB) nichtig sein. Oder der Käufer hat ein Anfechtungsrecht wegen Irrtums (§ 119 Abs. 2 BGB).
Kaufvertrag wegen Sittenwidrigkeit oder Wucher gem. § 138 BGB nichtig?
Verstößt ein Kunstkaufvertrag gegen die „guten Sitten“ oder beutet der Händler die Unerfahrenheit des Käufers dahingehend aus, dass zwischen dem Wert des Kunstwerks oder der Antiquität und dem Kaufpreis ein „auffälliges Missverhältnis“ besteht, so ist der Vertrag wegen Sittenwidrigkeit oder Wucher gem. § 138 BGB nichtig. Die Rechtsfolge ist, dass der Käufer die Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangen kann. D.h. die Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Kunstwerks. Es ist eine Situation herzustellen, als sei der Vertrag nie geschlossen worden. Wann aber verstößt ein Handel gegen die „guten Sitten“ und wo beginnt ein „auffälliges Missverhältnis“ in diesem Sinne? Und wie verhält es sich mit Drucken, Stichen oder Lithographien? Die Deutsche Rechtsprechung hat sich zu diesen Fragen verschiedentlich geäußert.
Sittenwidrigkeit ist Frage des Einzelfalls
Das Oberlandesgericht Bremen hat im Jahr 2003 ein Urteil bestätigt, mit dem der Käuferin von zwei Gemälden ein Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises gem. § 812, Abs. 1 BGB zuerkannt wurde. Nach der Ansicht der Gerichte war der Kunst-Kaufvertrag wegen sittenwidrigem Wucher (§ 138 BGB) nichtig. Dem Urteil lag jedoch ein etwas ungewöhnlicher Sachverhalt zugrunde. Der Verkäufer des Gemäldes hatte mit der Käuferin etwa acht Jahre lang in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammengelebt und dieser in den ersten Jahren der Beziehung zwei Ölgemälde eines zeitgenössischen italienischen Malers für einen Preis von zusammen DM 100.000 überlassen. Nach der Trennung im Jahr 1999 schätzte ein Kunstgutachter den Wert der Gemälde auf je nur DM 1.500. Gutachten, die der Verkäufer der Käuferin versprochen hatte, waren nie geliefert worden. Außerdem hatte die Käuferin den Betrag von DM 120.000 auf DM 100.000 herunter gehandelt.
Verwerfliche Gesinnung beim Kunstkauf
Das OLG Bremen schloss von dem krassen Missverhältnis zwischen dem niedrigen Wert der Kunstwerke und dem hohen Kaufpreis automatisch auf eine „verwerfliche Gesinnung“ des Verkäufers. Abei bezog es sich auf eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wonach diese Voraussetzung der Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 BGB gegeben ist, wenn sich der Verkäufer bewusst oder grob fahrlässig „der Einsicht verschließt, dass der andere Teil den Vertrag nur aus Mangel an Urteilsvermögen“ eingegangen ist. Beträgt der Kaufpreis mehr als das Doppelte des Wertes der Leistung (200-Prozent-Grenze), so wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine verwerfliche Gesinnung widerleglich vermutet. Diese Vermutung kommt nur dann nicht zur Anwendung, wenn sie im Einzelfall durch besondere Umstände erschüttert wird, etwa dadurch, dass dem Käufer der Kaufpreis nachweislich egal war und er „um jeden Preis“ gekauft hätte. Da die Käuferin den Preis allerdings gedrückt und auf Expertisen bestanden hatte, war ihr der Preis offensichtlich nicht egal gewesen.
„Gespaltener Markt“
Dagegen hat etwa das Oberlandesgericht Saarbrücken im Jahr 2001 einen Kunst-Kaufvertrag trotz hoher Differenz zwischen Kaufpreis und Wert für wirksam gehalten. Dabei vertrat das Gericht die Auffassung, dass die vom BGH zunächst für Immobiliengeschäfte entwickelte „Grenze des Doppelten“ nicht auf den Kunsthandel übertragbar sei, da „der Marktwert von Kunstgegenständen, namentlich der von Gemälde, erheblichen Schwankungen unterliegt und keineswegs so verlässlich festzustellen“ sei. Außerdem bemerkte das Gericht, dass bei der Bewertung des Missverhältnisses zu berücksichtigen sei, dass es sich beim Kunstmarkt um einen sogenannten „gespaltenen Markt“ handelt. Denn gewerbliche Kunsthändler könnten im Gegensatz zu privaten Käufern und Wiederverkäufern regelmäßig erheblich billiger ankaufen und zu erheblich höheren Preise verkaufen. Die Sittenwidrigkeit könne daher beim Kauf von einem Kunsthändler nicht einfach aus einem massiven Überschreiten des Einkaufspreises geschlossen werden.
Marktwert ermittelbar?
Nach der Erfahrung von Rechtsanwalt Dr. Rönsberg steht und fällt die Geltendmachung der Nichtigkeit eines Kunst-Kaufvertrags wegen Wuchers mit der Möglichkeit, einen mehr oder weniger objektiven Marktwert des Kunstwerks nachzuweisen. Und dieser Nachweis ist bei Serien von Gemälden oder bei Drucken und Lithographien regelmäßig einfacher zu führen als bei Einzelstücken. Denn dabei ist schlicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass Preise von kürzlich veräußerten vergleichbaren Stücken als Referenz herangezogen werden können. Übersteigt der für das Kunstwerk gezahlte Preis allerdings den von einem Sachverständigen ermittelten Preis um ein Vielfaches, so kann auch bei Einzelstücken Wucher gegeben sein.
Kaufvertrag wegen Irrtum über Wert gem. § 119 Abs. 2 BGB anfechtbar?
Sind die Voraussetzungen des sittenwidrigen Wuchers (§ 138 BGB) nicht gegeben, so stellt sich für den Anwalt als nächstes die Frage, ob dem Käufer ein Anfechtungsrecht wegen Irrtums gem. § 199 Abs. 2 BGB zusteht. Kann der Käufer den Kaufvertrag wirksam anfechten, so ist dieser gem. § 142 BGB als von Anfang an nichtig anzusehen. Die Folge ist – ähnlich wie bei der Nichtigkeit wegen Wuchers – ein Anspruch des Käufers auf Rückgewähr des Kaufpreises gegen Rückgabe des Kunstwerkes oder der Antiquität. Allerdings gewährt nicht jeder Irrtum ein Anfechtungsrecht und die Anfechtung muss gem. § 121 Abs. 1 BGB unverzüglich erfolgen, nachdem der Käufer von dem Irrtum Kenntnis erlangt hat und zudem innerhalb von zehn Jahren (§ 121 Abs. 2 BGB).
Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaft
Der Irrtum i.S.d. § 119 Abs. 2 BGB muss sich auf eine sogenannte „verkehrswesentliche Eigenschaft“ des Kunstwerks oder der Antiquität beziehen. Der Wert des Kaufgegenstandes selbst stellt keine Eigenschaft in diesem Sinne dar und ist somit unbeachtlich. Ein Irrtum über den Hersteller oder den Künstler bzw. über die „Echtheit“ des Kunstobjekts kann dagegen ein Anfechtungsrecht begründen. Denn in diesem Fall irrt der Käufer nicht über den Wert an sich, sondern über einen wertbildenden Faktor (Original oder Fälschung). Allerdings wird das Anfechtungsrecht wegen Eigenschaftsirrtums nach der Rechtsprechung ab Gefahrübergang, d.h. zumeist ab Übergabe des Kunstwerkes oder der Antiquität (§ 446 BGB), durch das Recht auf Mängelgewährleistung (§§ 459 ff. BGB) als Sonderregelung verdrängt. Nur soweit das Gemälde, die Skulptur, die Kommode usw. noch nicht übergeben wurde oder sich der Irrtum ausnahmsweise auf verkehrswesentliche Eigenschaften bezieht, die keine Gewährleistungsmängel darstellen, kann eine Vertragsanfechtung dennoch möglich sein.
Argistige Täuschung des Künstkäufers
Denkbar ist auch eine Anfechtung des Kaufvertrages wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 Abs. 1 BGB, wenn der Antiquitäten- oder Kunsthändler den Käufer absichtlich über den Wert des Kunstwerks oder der Antiquität oder über einen anderen Umstand getäuscht hat. Diese Anfechtung kann jedoch gem. § 124 Abs. 1 BGB nur innerhalb eines Jahres erfolgen und die Arglist des Verkäufers ist in der Regel schwer zu beweisen. Denn der Käufer, der in einem solchen Fall die Beweislast trägt, muss in subjektiver Hinsicht den Täuschungswillen des Verkäufers unter Beweis stellen. Das wird nur in Ausnahmefällen mittels Zeugen, Aufzeichnungen des Verkäufers o.ä. gelingen. Ähnlich steht es mit einem etwaigen Schadensersatzanspruch des Käufers aus „unerlaubter Handlung“ gem. §§ 823, 826 BGB i.V.m. §§ 263, 291 StGB). Denn dazu muss der Käufer des Kunstwerks oder der Antiquität die Voraussetzungen der Straftatbestände des Wuchers (§ 291 StGB) oder des Betruges (§ 263 StGB) unter Beweis stellen. Auch das wird nur in extremen Fällen gelingen.

Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Lösung von einem Antiquitäten- oder Kunstkaufvertrag wegen eines überhöhten Kaufpreises nur in besonderen Fällen möglich ist. Der im Kunstrecht erfahrene oder mit dem Antiquitätenhandel vertraute Rechtsanwalt wird hier im Einzelfall prüfen, ob die Voraussetzungen des Wuchers gegeben sind oder ob dem Käufer ein Anfechtungsrecht zusteht. Für Rückfragen steht Rechtsanwalt Dr. Louis Rönsberg gerne zur Verfügung. Rufen Sie jetzt unverbindlich an! +49 89 51 24 270
Verfasser des Artikels

Dr. Louis Rönsberg
Rechtsanwalt, Partner
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht