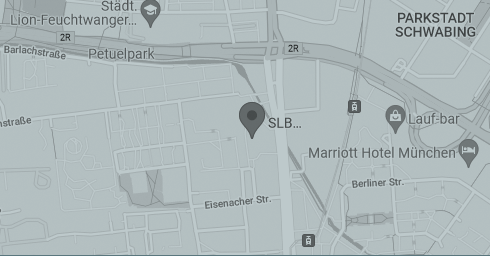Gesellschaftsgründung und Arbeitsrecht in Deutschland – Rechtliche Orientierung für italienische Unternehmen
Rechtssicherheit bei der Expansion – Orientierung für italienische Unternehmer
Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Italiens und ein attraktiver Standort für unternehmerisches Wachstum. Viele italienische Unternehmen erwägen daher eine Expansion in den deutschen Markt – sei es durch die Gründung einer Tochtergesellschaft, den Aufbau einer Vertriebsstruktur, die Eröffnung einer Betriebsstätte oder die Einstellung eigenen Personals vor Ort.
Mit dieser Entscheidung gehen jedoch zahlreiche rechtliche und praktische Fragestellungen einher, die ausländische Unternehmer regelmäßig vor Herausforderungen stellen:
- Welche Gesellschaftsform ist für mein Unternehmen in Deutschland geeignet?
- Wie läuft die Gründung einer GmbH oder einer Niederlassung konkret ab?
- Welche rechtlichen Unterschiede bestehen zwischen dem italienischen und dem deutschen Gesellschaftsrecht?
- Wie kann ich Mitarbeiter in Deutschland rechtssicher einstellen?
- Was muss ich beim Arbeitsrecht, bei Kündigungen und bei der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen beachten?
- Wie unterscheiden sich die arbeitsrechtlichen Pflichten eines Arbeitgebers in Deutschland von denen in Italien?
Neben den rein juristischen Aspekten treten oft auch kulturelle und administrative Unterschiede zutage, etwa im Umgang mit Behörden, bei der Gestaltung von Verträgen oder in der Erwartungshaltung von Arbeitnehmern. Auch hier ist eine präzise rechtliche und strategische Planung essenziell.
Insbesondere kleine und mittlere italienische Unternehmen (PMI), die zum ersten Mal außerhalb Italiens tätig werden, benötigen eine verlässliche rechtliche Orientierung, um den Markteintritt effizient und risikobewusst zu gestalten. Aber auch erfahrene Unternehmen mit internationaler Struktur sehen sich regelmäßig mit komplexen Fragen zur Haftung, Compliance, Personalführung und Geschäftsleitung konfrontiert.
Ziel dieser Seite ist es daher, eine erste rechtliche Orientierung zu bieten – klar gegliedert, sachlich aufbereitet und speziell auf die Bedürfnisse italienischer Unternehmer zugeschnitten. Im Mittelpunkt stehen dabei praxisrelevante Fragen des Gesellschafts- und Arbeitsrechts, da gerade in diesen Bereichen der Beratungsbedarf in der Praxis besonders hoch ist.
1. Gesellschaftsgründung in Deutschland – rechtliche Grundlagen für italienische Unternehmen
Die Entscheidung, in Deutschland eine Tochtergesellschaft oder eine Niederlassung zu gründen, ist für italienische Unternehmer mit einer Vielzahl rechtlicher und struktureller Überlegungen verbunden. In der Praxis zeigt sich, dass insbesondere die Wahl der richtigen Gesellschaftsform, die formalen Gründungsschritte sowie die Unterschiede zum italienischen Rechtssystem häufig Anlass für Unsicherheiten geben.
Wahl der passenden Rechtsform
Grundsätzlich stehen italienischen Unternehmern bei der Expansion nach Deutschland verschiedene Rechtsformen zur Verfügung. Besonders häufig gewählt werden:
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): Die GmbH ist die am weitesten verbreitete Rechtsform für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland. Sie bietet eine klare Trennung zwischen Gesellschaftsvermögen und persönlicher Haftung und ist als eigenständige juristische Person rechtsfähig. Das gesetzlich vorgeschriebene Stammkapital beträgt mindestens 25.000 €, wobei 12.500 € zur Gründung eingezahlt werden müssen.
- Zweigniederlassung (filiale): Alternativ zur Gründung einer eigenständigen Gesellschaft kann ein italienisches Unternehmen in Deutschland eine unselbstständige Zweigniederlassung errichten. Diese unterliegt deutschen Melde- und Registrierungspflichten, bleibt jedoch rechtlich Teil des italienischen Unternehmens und besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit.
Die Wahl der geeigneten Struktur hängt maßgeblich von strategischen, steuerlichen und haftungsrechtlichen Erwägungen ab. Ebenso sind branchenspezifische Regelungen, Kapitalanforderungen und organisatorische Vorgaben zu berücksichtigen.
Gründungsprozess und rechtliche Anforderungen
Die Gründung einer Gesellschaft in Deutschland erfordert die Beachtung mehrerer rechtlicher Schritte:
- Vorbereitung der Gesellschaftsverträge: In deutscher Sprache und unter Beachtung zwingender gesetzlicher Vorgaben (z. B. zur Geschäftsführung, Vertretung, Kapitalstruktur)
- Notarielle Beurkundung der Satzung: Pflicht bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, UG)
- Eintragung in das Handelsregister: Die Eintragung erfolgt durch den Notar und begründet die rechtliche Existenz der Gesellschaft
- Anmeldung bei Finanz- und Gewerbebehörden: Anmeldung beim Finanzamt (für steuerliche Erfassung) sowie je nach Tätigkeit beim Gewerbeamt
- Eröffnung eines deutschen Geschäftskontos: Voraussetzung für die Einzahlung des Stammkapitals
- Ernennung und Legitimation der Geschäftsführer: Auch ausländische Geschäftsführer sind zulässig, unterliegen jedoch bestimmten Nachweispflichten
Dabei ist zu beachten, dass sämtliche Unterlagen und Verträge den deutschen formalen Anforderungen genügen müssen und meist eine beglaubigte Übersetzung erforderlich ist, sofern diese im Ausland erstellt wurden.
Rechtliche Unterschiede zwischen Italien und Deutschland
Im Vergleich zur italienischen Praxis unterscheiden sich insbesondere:
- Gründungsformalitäten: In Deutschland erfolgt die Gesellschaftsgründung zwingend vor einem Notar und ist eng mit dem Handelsregister verknüpft. Die Eintragung ist konstitutiv.
- Haftungsregelungen: Die Trennung zwischen Gesellschafts- und Privatvermögen ist in Deutschland strikter ausgestaltet. Geschäftsführer haften nur in Ausnahmefällen persönlich. Die Wahl der Rechtsform ist entscheidend.
- Geschäftsführerbestellung und -haftung: Die Anforderungen an Geschäftsführer – insbesondere hinsichtlich Sorgfaltspflichten, Insolvenzvermeidung und Vertretungsmacht – sind umfassend geregelt und sanktioniert.
- Transparenzregister: Unternehmen in Deutschland sind verpflichtet, wirtschaftlich Berechtigte offenzulegen. Dies kann in Konzernstrukturen oder bei Treuhandverhältnissen zusätzliche Pflichten auslösen.
Für italienische Unternehmer ist es daher unerlässlich, sich frühzeitig mit den spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Gesellschaftsrechts vertraut zu machen und die Unternehmensstruktur mit rechtlicher Beratung abzustimmen.
2. Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen für italienische Unternehmen
Die Beschäftigung von Personal in Deutschland bringt für italienische Unternehmen eine Reihe rechtlicher Anforderungen mit sich, die sich deutlich vom italienischen Arbeitsrecht unterscheiden. Wer in Deutschland eine Tochtergesellschaft, Niederlassung oder einen Betriebsstandort betreibt, muss sich frühzeitig mit dem deutschen Arbeitsrecht auseinandersetzen, um rechtliche Risiken zu vermeiden und den Betrieb auf stabile arbeitsrechtliche Grundlagen zu stellen.
Bereits bei der Begründung von Arbeitsverhältnissen stellen sich grundlegende Fragen: Welche Form muss ein Arbeitsvertrag haben? Welche Angaben sind verpflichtend? Wie gestalten sich Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche und Vergütungsmodelle nach deutschem Recht? Wie sind Teilzeitkräfte zu behandeln? Welche Pflichten bestehen gegenüber Sozialversicherungsträgern?
Auch bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen gelten klare gesetzliche Vorgaben: Fristen, Formerfordernisse und mögliche Kündigungsgründe müssen ebenso berücksichtigt werden wie der Anwendungsspielraum des Kündigungsschutzgesetzes. Unklare oder unvollständige Regelungen führen hier schnell zu Auseinandersetzungen, die vor dem Arbeitsgericht enden können – mit erheblichen Kosten- und Reputationsrisiken für das Unternehmen.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist der unterschiedliche Umgang mit Themen wie Probezeit, Abmahnung, Kündigung, Überstunden oder betriebsbedingtem Personalabbau. Viele dieser Konzepte unterscheiden sich in ihrer Reichweite, praktischen Umsetzung und rechtlichen Bewertung deutlich von den italienischen Gepflogenheiten.
Für italienische Unternehmer bedeutet dies, dass sie beim Aufbau ihres Geschäfts in Deutschland nicht nur mit einem neuen Markt, sondern auch mit einem neuen arbeitsrechtlichen System konfrontiert sind. Wer ohne qualifizierte arbeitsrechtliche Beratung Verträge schließt oder Personalentscheidungen trifft, riskiert unnötige Komplikationen und finanzielle Belastungen.
Pflichten als Arbeitgeber in Deutschland:
- Anmeldung bei Sozialversicherungsträgern
- Abschluss schriftlicher Arbeitsverträge nach deutschem Recht
- Einhaltung von Arbeitszeit-, Urlaubs- und Arbeitsschutzvorschriften
- Berücksichtigung von Mitbestimmungsrechten in bestimmten Betriebsgrößen
3. Arbeitsverträge und Kündigungsrecht
Bei der Anstellung von Mitarbeitenden ist ein klar formulierter Arbeitsvertrag unerlässlich. Dieser muss den Anforderungen des deutschen Nachweisgesetzes entsprechen und enthält normalerweise Regelungen zu Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub, Kündigungsfristen und Wettbewerbsverboten.
Typische Vertragsarten:
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Befristeter Vertrag (zeitlich oder zweckgebunden)
- geringfügige Beschäftigung (556 EUR/Monat)
Arbeitsverträge: Form, Inhalt und Transparenzpflichten
In Deutschland gilt für unbefristete Arbeitsverträge grundsätzlich Formfreiheit. Dennoch ist aus Gründen der Rechtssicherheit dringend zu empfehlen, schriftliche Verträge abzuschließen. Spätestens seit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1152 (Transparenzrichtlinie) sind Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitenden bestimmte wesentliche Arbeitsbedingungen schriftlich zu bestätigen – idealerweise im Arbeitsvertrag selbst. Die Anforderungen der europäischen Transparenzrichtlinie hat Deutschland durch das sog. Nachweisgesetz umgesetzt.
Ein deutscher Arbeitsvertrag sollte demnach u.a. folgende Angaben enthalten:
- Name und Anschrift beider Vertragsparteien
- Beginn des Arbeitsverhältnisses, ggf. Dauer (bei Befristung)
- Probezeit und ggf. DauerTätigkeitsbeschreibung und Arbeitsort
- Arbeitszeit und Pausenregelung
- Höhe und Zusammensetzung der Vergütung (inkl. Zuschläge, Boni)
- Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung
- Urlaubstage pro Kalenderjahr
- Kündigungsfristen und Hinweise zum Kündigungsverfahren
Die zweisprachige Ausfertigung (Deutsch/Italienisch) ist in grenzüberschreitenden Konstellationen sinnvoll, aber die deutsche Fassung sollte im Streitfall maßgeblich sein.
Probezeit und Kündigungsschutz
In vielen Fällen wird zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses eine Probezeit vereinbart. Diese darf bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen höchstens sechs Monate betragen. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden – vorausgesetzt, dies ist ausdrücklich im Vertrag geregelt.
Unabhängig von der Probezeit beginnt der gesetzliche Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) erst nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit („Wartezeit“). In Unternehmen mit mehr als zehn Vollzeitbeschäftigten gilt das KSchG. Kleinbetriebe sind grundsätzlich davon ausgenommen.
Nach Ablauf dieser Wartezeit ist eine Kündigung nur zulässig, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Das Gesetz unterscheidet zwischen vier Kündigungsarten:
Kündigungsarten im deutschen Arbeitsrecht
1. Verhaltensbedingte Kündigung
Diese beruht auf einem schuldhaften Fehlverhalten des Arbeitnehmers (z. B. wiederholte Unpünktlichkeit, Arbeitsverweigerung). In der Regel ist eine vorherige Abmahnung erforderlich.
2. Personenbedingte Kündigung
Hier liegt die Ursache in der Person des Arbeitnehmers, etwa bei chronischer Krankheit, Verlust der Fahrerlaubnis oder Inhaftierung, sofern dadurch die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten dauerhaft beeinträchtigt ist.
3. Betriebsbedingte Kündigung
Diese erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen (z. B. Auftragsrückgang, Standortschließung). Sie setzt eine ordnungsgemäße Sozialauswahl voraus, bei der u. a. Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten zu berücksichtigen sind.
4. Außerordentliche (fristlose) Kündigung
Sie ist nur bei schwerwiegendem Fehlverhalten möglich – etwa Diebstahl mit Bezug zum Arbeitsverhältnis, grobe Beleidigung oder Tätlichkeit. Sie muss innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung ausgesprochen werden.
Formvorgabe: Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und eigenhändig unterschrieben sein. Mündliche oder elektronische Kündigungen sind nicht rechtswirksam.
Rechtsmittel: Der Arbeitnehmer kann gegen eine Kündigung innerhalb von drei Wochen nach Zugang Klage beim Arbeitsgericht erheben. Wird diese Frist versäumt, gilt die Kündigung als wirksam – auch wenn sie fehlerhaft war.
Arbeitszeit, Vergütung und Urlaub
Arbeitszeit
Die gesetzliche Höchstarbeitszeit liegt bei acht Stunden pro Werktag (§ 3 ArbZG). Sie kann auf zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen ein Durchschnitt von acht Stunden eingehalten wird. Sonn- und Feiertagsarbeit ist grundsätzlich untersagt, aber ausnahmsweise möglich.
Vergütung
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit 1. Januar 2024 12,41 Euro brutto pro Stunde. Für bestimmte Branchen (z. B. Bau, Pflege, Elektrohandwerk) gelten höhere tarifliche Mindestlöhne.
Urlaub
Arbeitnehmer haben bei einer 5-Tage-Woche gesetzlichen Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage pro Jahr. In der Praxis sind oft 25 bis 30 Tage üblich. Auch Teilzeitkräfte haben bei entsprechender Verteilung Anspruch auf denselben Urlaubsanspruch wie Vollzeitbeschäftigte – bezogen auf die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage.
Fazit
Das deutsche Arbeitsrecht ist stark formalisiert und arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet. Für italienische Unternehmen ist es daher unerlässlich, alle arbeitsrechtlichen Fragen von Beginn an fachkundig zu prüfen, um spätere Risiken zu vermeiden. SLB LAW unterstützt Arbeitgeber bei der rechtssicheren Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen, der Entwicklung innerbetrieblicher Regelungen sowie in arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen – zuverlässig, strukturiert und mit Blick auf die unternehmerische Praxis.
Italienischsprachige Rechtsberatung in Deutschland
SLB LAW bietet umfassende rechtliche Unterstützung für italienische Unternehmen, die in Deutschland tätig sind oder werden möchten. Als Full-Service-Kanzlei mit ausgewiesener Spezialisierung im Gesellschafts- und Arbeitsrecht begleitet der Italian Desk Mandanten in ihrer Muttersprache – rechtlich präzise und kulturell verständig.
Unsere Beratung erfolgt durch italienischsprachige Rechtsanwälte, teilweise mit Doppelzulassung in Deutschland und Italien und umfasst sowohl präventive Vertragsgestaltung als auch die Vertretung in rechtlichen Auseinandersetzungen. Für steuerliche Fragestellungen bestehen enge Kooperationen mit erfahrenen deutschen Steuerberatern.
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Italian Desk auf. Wir beraten Sie gerne vertraulich und individuell zu Ihrem Vorhaben in Deutschland.
Verfasser des Artikels